|
Im
Gegensatz zu den Vorserienloks hat man die E 10-Serienloks mit einer
elektrischen Widerstandsbremse ausgerüstet. Dies war wegen der größeren
Höchstgeschwindigkeit nötig. Da die Bewegungsenergie proportional zum
Quadrat der Geschwindigkeit wächst, ist für ein Abbremsen aus einer
Geschwindigkeit von 150 km/h etwa 33 % mehr Energie abzuführen als bei
einem Abbremsen aus einer Geschwindigkeit von 130 km/h. Bei Benutzung
von Klotzbremsen wird die Bewegungsenergie in Wärmeenergie umgewandelt,
die die Bremsklötze und Räder stark aufheizt. Dies hat einen hohen
Bremsklotzverschleiß zur Folge und kann zum Loslösen des Radreifens
führen.
Bei einer elektrischen Widerstandsbremse macht man sich zunutze, daß
jeder Elektromotor zugleich als Generator wirken kann. Wird dem Läufer
Strom zugeführt und im Ständer ein Magnetfeld erzeugt, so dreht sich der
Läufer und kann zum Antreiben der Lok benutzt werden. Wird umgekehrt der
Läufer durch die fahrende Lok bewegt und dafür gesorgt, daß im Ständer
ein Magnetfeld erzeugt wird, so wird im Läufer eine Spannung induziert,
die in einem Stromkreis einen Strom hervorrufen kann. Gleichzeitig wird
die Lok abgebremst. Nun stellt sich aber die Frage, was mit diesem
Bremsstrom geschehen soll. Da er phasenverschoben zum Fahrstrom ist,
kann er nicht in die Oberleitung zurückgespeist werden. Daher läßt man
den Bremsstrom über einen Bremswiderstand laufen, in dem der Strom in
Wärmeenergie umgewandelt wird. Die Bremsleistung der Lok wird bei diesem
Verfahren allerdings durch die Größe des Bremswiderstandes beschränkt.
So hat der Bremswiderstand bei der E 10 einen Widerstandswert von 0,189
Ohm und eine Dauerleistung von 1200 kW. Bei dieser Leistung kann die
durch die Erwärmung des Widerstandes auf 550°C auftretende Wärme gerade
noch durch den Widerstandslüfter abgeführt werden. Der Lüfter saugt die
Luft aus dem Maschinenraum an und drückt die Warmluft aus der kleinen
Dachhaube ins Freie. Kurzzeitig kann die Bremsleistung bis auf 2500 kW
erhöht werden.
Wie schon erwähnt wurde, kann der Läufer nur bremsend wirken, wenn im
Ständer ein Magnetfeld (eine Erregung) vorliegt. Dieses Magnetfeld kann
zum Beispiel dadurch erzeugt werden, daß nach anfänglicher Erregung
durch die Lok-Batterie ein Teil des vom Läufer erzeugten Stroms für die
weitere Erregung abgezweigt wird. Dieses Verfahren hätte aber den
Nachteil, daß sich die Bremsleistung ständig verändern würde. Je
langsamer der Läufer würde, desto weniger Strom würde er erzeugen, womit
das Magnetfeld immer schwächer und die Abbremsung des Läufers immer
geringer würde. Um eine konstante Bremskraft zu erhalten, muß das
Magnetfeld mit langsamer werdendem Läufer immer stärker werden. Dies
erreicht man mit einer an der Lokachse angebrachten Tachomaschine, die
die vom Loktrafo gelieferte Erregerspannung von 40,5 V in Abhängigkeit
von der Achsgeschwindigkeit variiert. Man nennt diese Bremse daher "fremderregte,
fahrleitungsabhängige Gleichstrom-Widerstandsbremse".
Die elektrischen Bremsen der ersten Serien-E 10 lassen sich allerdings
nicht stufenlos stellen. Es stehen vielmehr nur fünf Stufen zur
Verfügung, in denen
20 %, 40 %, 60 %, 80 % oder 100 % der vollen Bremskraft wirksam werden.
Da man bei den Altbau-Elloks der Baureihen E 44 und E 94, die mit
elektrischer Bremse ausgerüstet waren, beobachtet hatte, daß diese
Bremse von den Lokführern selten genutzt wurde, hat man den elektrischen
Bremssteller der Neubau-Elloks mit dem Führerbremsventil gekoppelt. Der
Lokführer hat damit die Möglichkeit, den elektrischen Bremssteller zu
lösen und beide Bremsen getrennt zu bedienen. Dies wird er bei längeren
Gefällestrecken tun. um die Bremsklötze zu schonen. Ansonsten wirken
dank der Kopplung der Bedienungshebel immer elektrische und
Druckluft-Bremse zusammen. Beim gekuppelten Bremsen wird bei wirkender
elektrischer Bremse die Druckluftbremse nur vorgesteuert. Der vom
Steuerventil gegebene Vorsteuerdruck kann durch die Absperrung des
erregten Magnetventils für Vorsteuerung jetzt nicht wirksam werden.
Dieser Zustand bleibt bis zum Abschalten der elektrischen Bremse
erhalten. Beim Ausfall der elektrischen Bremse setzt sofort die
entsprechend vorgesteuerte Druckluftbremse mit „hoher" bzw. unterhalb 55
km/h mit „niedriger" Abbremsung Bei der Betriebsbremsung wirkt die
elektrische Bremse im Bereich von 150 bis 25 km/h. Darunter übernimmt
die Druckluftbremse das Abbremsen. Beim Ausfall der elektrischen Bremse
übernimmt die Druckluftbremse bei jeder Geschwindigkeit das Abbremsen.
Die Loks der Baureihe 110/113 sind mit einer Durchgehende selbsttätige
mehrlösigen Druckluftbremse der Bauart KE sowie den Bremsstellungen G P
R ausgerüstet Die Betätigung des Steuerventils erfolgt durch die
Führerbremsventile der Bauart D5. In den Lokomotiven sind Steuerventile
und Druckübersetzer eingebaut. Die vier Bremszylinder der Lokomotive
werden über den Druckübersetzer aus einem 3OO Lieter Vorratsluftbehälter
mit Bremsluft versorgt. Fahrgeschwindigkeitsabhängig wird der
Druckübersetzer vom Bremsdruckregler am Radsatzlager gesteuert. Dieser
wird vom Radsatz 2 - linke Lokseite - angetrieben. Die Umschaltung von
„hohe" auf „niedrige" Abbremsung erfolgt bei Geschwindigkeiten kleiner
als 55 km/h. Der höchste Bremszylinderdruck beträgt bei hoher Abbremsung
8 bar und bei niedriger Abbremsung 3,8 bar. Die hohe Abbremsung wirkt
nur in Bremsstellung ,,R". ein. An jedem Drehgestell findet man zwei
Bremszylinder, und die Bremsklötze und das Bremsgestänge, das zwecks
guter Wartungsmöglichkeiten möglichst einfach und gut zugänglich
ausgeführt wurde.
|
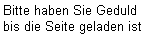 Bremsen
Bremsen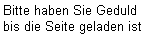 Bremsen
Bremsen
