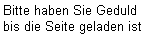 Stromabnehmer
Stromabnehmer 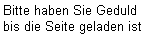 Stromabnehmer
Stromabnehmer
|
Den Kontakt
zwischen dem Fahrdraht und den elektrischen Ausrüstungsgegenständen der
Lok stellt der Stromabnehmer her.Die Serienloks der Baureihe 110
erhielten einen neuen Stromabnehmer, mit der Bezeichnung DBS 54 ( Soll
heißen Doppelschleifstück-Bahn-Stromabnehmer Entwicklungsjahr 1954).Der
275 kg schwere DBS 54, war dank der Verwendung von Leichtmetall 100 kg
leichter als sein Vorgängermodell (SBS 39) und besteht aus einem
Grundrahmen, der mit Hilfe von vier Isolatoren am Lokomotivdach
befestigt ist. Auf der linken und rechten Seite des Grundrahmens sitzt
je eine Schere. Wälzlager, mit Kupferdrähten überbrückt, sorgen für die
zur Höhenregulierung nötige Beweglichkeit.Auf den Scheren sitzt eine
federnd gelagerte Wippe mit zwei Schleifstücken. Dank der Wippe können
Unebenheiten bei der Fahrdrahtaufhängung sowie Bewegungen des Lokkastens
aufgefangen werden, so daß immer ein guter Kontakt gewährleistet ist.
Mit diesem Stromabnehmer ist daher ein Betrieb mit einem Stromabnehmer
bis 160 km/h möglich. Zum Heben und Senken besitzt er Federn. Beim
Anheben wird die Senkfeder von einem per Druckluft bewegten Kolben
zusammengedrückt, so daß nur die Hubfeder wirkt. Beim Senken entweicht
die Druckluft des Antriebskolbens, wodurch die Senkfeder den
Stromabnehmer herunterzieht, denn ihre Federkraft ist größer als die der
Hubfeder. Für die Schleifstücke benutzt man Hartkohle. Im Normalbetrieb
wird jeweils der hintere Stromabnehmer der Lok benutzt. Der vordere
Stromabnehmer wird dann eingesetzt, wenn hinter der Lok Wagen laufen,
die durch Funkenflug gefährdet sind (z.B. Tankwagen mit Benzin. Gas u.a.)
oder solche, die Güter befördern, die möglichst wenig verschmutzt werden
sollen (z.B. Autotransportwagen). Bei Doppeltraktion dürfen nur die
jeweils äußeren Stromabnehmer benutzt werden, um den Druck auf die
Fahrleitung besser zu verteilen, immerhin wird jeder Stromabnehmer mit
rund 70 kN angepreßt.Bei Schnellfahrversuchen mit den Loks E 10 299 und
300 in den Jahren 1963 und 1964 wurden verschiedene Stromabnehmertypen
im Geschwindigkeitsbereich bis 200 km/h getestet. Dabei schnitten der
Scherenstromabnehmer DBS 54, ausgerüstet mit einer Wanisch-Wippe WB 15,
sowie der Einholmstromabnehmer SBS 65 am besten ab.Die E
03-Vorserienloks wurden je zur Hälfte mit diesen Stromabnehmern
ausgerüstet. Um Züge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h mit
zwei Loks der Baureihe 112 befördern zu können, beschloß man 1968, auch
die in Bau befindlichen Loks 112 485 bis 504 mit dem DBS 54 und
Wanisch-Wippe WB 15 auszurüsten. Der DBS 54 in Normalausführung war für
Vorspannfahrten mit dieser Geschwindigkeit nicht geeignet. Der
Einholmstromabnehmer hätte einen anderen Senkantrieb erfordert. Anders
als bei den Versuchsfahrten bewährte sich die Wippe WB 15 im Alltag bei
Fahrten im Hochgeschwindigkeitsbereich nicht. Nach zahlreichen
Betriebsstörungen wurden die mit den Wippen WB 15 ausgerüsteten
Stromabnehmern von den Schnellfahrloks abgebaut und auf Loks der
Baureihe 140 und 141 "abgefahren".Auf den Loks 112 485 und 486 wurden
daraufhin im Jahre 1969 zwei neue Wippen für den Stromabnehmer DBS 54
getestet, wobei die von der Firma ETK gefertigte Wippe mit der
Bezeichnung B 12 bessere Ergebnisse lieferte als die von der Firma
Siemens gelieferte Wippe. Die Loks 112 485 bis 504 sowie die ersten
Serienloks der Baureihe 103 erhielten daraufhin diese Wippe B 12, die
auf Stromabnehmer vom Typ DBS 54 montiert war, welche eine zusätzliche
Oberscherendämpfung erhalten hatten.Doch auch diese Wippen bewährten
sich im Dauerbetrieb nicht.Nachdem sie zahlreiche Oberleitungsschäden
verursacht hatten, mußten sie - wie ihre Vorgängerinnen - von den Loks
der Baureihen 103 und 112 weichen und beendeten auf Loks der Baureihen
140 und 141 ihr Dasein.Die Loks der Baureihe 112 liefen von nun an mit
dem DBS 54 in Normalausführung ,sieht man von einer weiteren
Versuchswippe im Jahre 1974 ab, die auf zwei 112ern getestet wurde. |