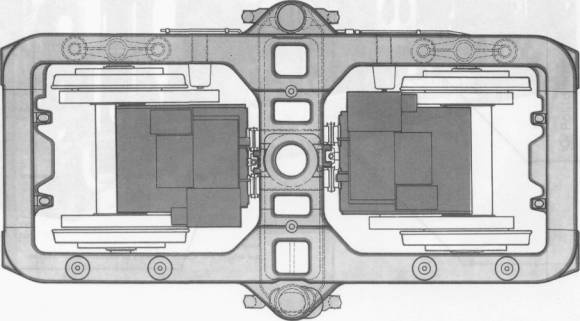Der Drehgestellrahmen besteht aus Längs- und Querträgern, die aus Blechen kastenförmig zusammengeschweißt
sind und als Hohlkörper ausgebildet sind. Durch Diese Hohlträger erhielt man
bei geringem Gewicht eine hohe Festigkeit und Widerstandskraft. Im mittleren Querträger ist. weit nach unten gezogen, das Drehzapfenlager angeordnet, in dem der am Brückenrahmen befestigte Drehzapfen beweglich gelagert ist.
In diese Führung ragt der am Rahmen der Lok befestigte Drehzapfen hinein, der die gesamten Zugkräfte vom Drehgestell auf den Rahmen und damit auf den Zughaken übertragen muß.
Damit die beiden vorauslaufenden Achsen der Drehgestelle beim Anfahren eines schweren Zuges nicht so sehr nach oben gezogen und damit entlastet werden, sind die Drehzapfenlager möglichst tief im Drehgestell, nur ungefähr 50 cm über der Schienenoberkante, angeordnet. Dadurch sind die Drehzapfen recht
lang Diese Tiefanlenkung am Drehzapfen verringert die Entlastung des jeweils vorauslaufenden Radsatzes beim Anfahren und trägt dadurch zu den guten Anfahreigenschaften der Lokomotive bei.
Bei den zweiachsigen Drehgestellen läuft über die Drehgestellmitte ein Zwischenträger, der die Drehzapfenführung enthält.
. Sie müssen aber die in Längsrichtung der Lok wirkenden Zug- und Stoßkräfte übernehmen. Querbewegungen werden durch zwei Rückstellfedern beiderseits eines jeden Drehzapfens aufgefangen. Um auftretende Reibung möglichst gering zu halten, schwimmen die Drehzapfenlager in ölgefüllten Stahlblöcken.
Wegen ihrer schwimmenden Lage können die Drehzapfen keine Abstützfunktion für den Rahmen vornehmen. Die Abstützung übernehmen bei den ersten Einheits-Elloks Schraubenfedern, von denen je eine auf jeder Drehgestellseite zu finden ist. Ihre Führungskästen gleiten bei Drehungen der Drehgestelle auf geschmierten
Hartmanganleisten am Lokrahmen. Die Lokrahmen besitzen also vier Abstützungen. Da sich,
diese Art der Abstützung nicht bewährt hat, wurden an zahlreichen Loks des ersten Typenprogramms konstruktive Verbesserungen
vorgenommen . Damit sich die Drehgestelle beim Entgleisen oder Aufgleisen nicht vom Lokrahmen lösen, sind sie mit Aufhängestangen lose mit dem Brückenrahmen
verbunden.
An den Drehgestellen befindet sich die elektro-pneumatisch betätigte Sandstreueinrichtung. Der Lokführer hat die Möglichkeit, entweder die Magnetventile der Streueinrichtung der in Fahrtrichtung vordersten Achse oder die Ventile der Streueinrichtungen der vorderen Achsen beider Drehgestelle elektrisch zu betätigen.
Probleme führen zu
Bauartänderungen
Sofort nach der Indienststellung der ersten Serien-E 10 zeigten sich
konstruktive Mängel. Der größte Mangel waren die schlechten
Laufeigenschaften der Lok. Bei Geschwindigkeiten oberhalb von 80 km/h
begannen die
Drehgestelle - durch schlechten Oberbau angeregt - Nickschwingungen
durchzuführen, die bei zunehmender Geschwindigkeit so heftig wurden,
dass die Achslagergehäuse gegen den Drehgestellrahmen schlugen.
Gleichzeitig setzten Wankbewegungen der Brücke gegenüber den
Drehgestellen ein. In Kurven fing sich die Lok jedoch wieder. Die DB zog
zunächst die Konsequenz, auf geraden Streckenabschnitten mit schlechtem
Oberbau die Höchstgeschwindigkeit beim Befahren mit Neubau-Elloks auf 80
km/h herabzusetzen. Gleichzeitig wurde das BZA Minden beauftragt, bei
Probefahrten zwischen Offenburg und Basel Schwingungsdämpfungs-maßnahmen
auf ihre Brauchbarkeit hin zu untersuchen. Dabei stellte man fest, dass
man befriedigende Laufeigenschaften erzielte, wenn man bei der
Achslagerfederung Gummifedern anstelle von Stahlfedern benutzte und
parallel zur Brückenabstützung Teleskopstoßdämpfer einbaute. Alle
schnellfahrenden Neubau-Elloks - also Loks der Baureihen E 10 und E 41 -
die bis Mitte 1957 ausgeliefert worden waren, erhielten umgehend die
genannten Teile eingebaut, da sich zu diesem Zeitpunkt bereits
zahlreiche Federbrüche und Brüche an Ausrüstungsteilen der Loks ereignet
hatten, die auf das schlechte Laufverhalten zurückzuführen waren.
Neubauten rüstete man gleich mit den Zusatzteilen aus.Außer durch ihre
schlechten Laufeigenschaften fielen die Drehgestelle durch eine weitere
schlechte Eigenschaft auf: Sie ließen sich sehr schwer drehen. Eine
Kraft von 15 W (entsprechend 1,5 t!) war am Spurkranz nötig, um die
Drehbewegung eines Drehgestells hervorzurufen. Dies hatte einen hohen
Radreifenverschleiß bei Kurvenfahrt zur Folge. Die E 10-Radreifen hatten
nur eine halb so große Lebensdauer wie die der E 44. Versuche zeigten,
dass man diesen unhaltbare Zustand dadurch verbessern konnte, dass die
Gleitschienen an der Brücke aus Gummi statt aus Stahl gefertigt wurden.
Nun waren selbst zur Vollauslenkung des Drehgestells Kräfte von nur max.
8kN (entsprechend 800kg) nötig. Die Loks der ersten Lieferungen wurden
entsprechend nachgerüstet. Aber trotz der, Hilfsmaßnahmen waren die
Laufeigenschaften der Drehgestelle nicht gut. Vor allem bei
Geschwindigkeiten über 140km/h waren sie; kaum noch befriedigend. Daher
beauftragte man die drei E 10-Herstellerfirmen Krupp, Krauss-Maffei und
Henschel mit der Konstruktion von neuen Drehgestellen.
Anfang 1960 lieferten diese Firmen ihre Versuchsdrehgestelle ab.
Vergleichsmessungen mit den Seriendrehgestellen belegten, dass die
Laufeigenschaften des Henschel-Drehgestells bei Geschwindigkeiten bis
140 km/h etwas besser, darüber aber deutlich besser als beim
Seriendrehgestell waren. Das Krauss-Maffei-Drehgestell zeigte bei allen
Geschwindigkeiten schlechtere Laufeigenschaften. Das Krupp-Drehgestell
wurde vorübergehend in E 10170 eingebaut. Es zeigte derart schlechte
Laufeigenschaften, dass die Lok vom Bw Heidelberg für die Dauer des
Versuchseinsatzes fast nur vor Güterzügen eingesetzt werden konnte. Die
DB zog daraus die Konsequenz, aus Gründen der Einheitlichkeit die
Neubauten der Serien-E 10 weiterhin mit den Seriendrehgestellen
auszurüsten. Lediglich einige E 10, deren Höchstgeschwindigkeit über 150
km/h liegen sollte, erhielten Henschel-Drehgestelle.
Damit waren die Drehgestell-Versuche aber noch nicht abgeschlossen.
Krauss-Maffei verbesserte die Konstruktion ihres Versuchsdrehgestells.
Nun übertraf es in der Laufruhe alle übrigen E 10-Drehgestelle. Da aber
zum Zeitpunkt seiner Bewährung (Ende 1967) bereits die Bestellung der
letzten E 10-Bauserien erfolgte (Auslieferung bis März 1969), blieb das
Krauss-Maffei-Versuchsdrehgestell leider ein Einzelstück. Es stand aber
bei der Konstruktion der Drehgestelle der Baureihe 111 Pate. Schließlich
verfügte man 1986 die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit aller Loks
mit Seriendrehgestellen auf 140 km/h wegen ihrer bescheidenen
Laufeigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten. 1991 musste wegen Schäden
an den Drehgestellen und den Antrieben die Höchstgeschwindigkeit der
Loks mit Henschel-Drehgestellen zeitweise sogar auf 120 km/h
herabgesetzt werden. Erst umfangreiche Maßnahmen erlaubten wieder die
alte Höchstgeschwindigkeit.
|
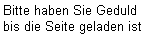 Drehgestellrahmen
Drehgestellrahmen
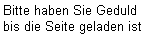 Drehgestellrahmen
Drehgestellrahmen